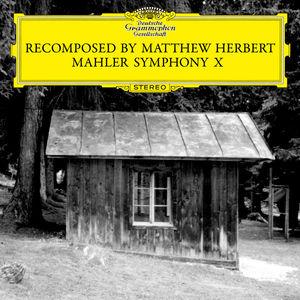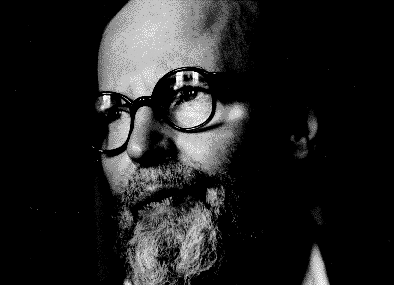Heute wurden die Preisträger des ECHO Klassik 2010 bekanntgegeben. Wir lassen uns noch einmal auf der Zunge zergehen: dies ist der Jahrespreis, der von der Deutschen Phono-Akademie e. V. vergeben wird, einer Interessengemeinschaft der (kommerziellen) Phonowirtschaft. Das wird schnell vergessen, wenn man die Preisträger-CDs unhinterfragt als "beste" Aufnahmen des Jahres ihrer Kategorie hinnimmt. Hier auf dem Blog kommtiere ich die Entscheidungen, freue mich natürlich über Antworten oder Diskussion.
* Joyce DiDonato und Jonas Kaufmann sind Sänger dieses Jahres. Qual der Wahl vermutlich - auf dem Gebiet der alten Musik ist DiDonatos Stimme zumindest gewöhnungsbedürftig.
* Martin Schmeding, Siegbert Rampe, Tabea Zimmermann (endlich!), Albrecht Mayer als Instrumentalisten des Jahres. Für die Orgel hätte ich allerdings doch
Hansjörg Albrecht den Vortritt gelassen. Was in der Instrumentalkategorie erneut Lang Lang zu suchen hat, und auch noch mit der gähnend langweiligen
Trio-Einspielung, will mir nicht in den Kopf.
* Paavo Järvi ist Dirigent des Jahres. Ich ziehe, was Beethoven angeht, derzeit Herreweghe und vor allem Dausgaard vor. Järvi arbeitet glatt, sauber, ordentlich und ist daher für mich nicht preiswürdig. Schon spannender finde ich den zweiten Echo, den "seine" Bremer für Janine Jansens exorbitante
Britten-Interpretation erhalten. Das Beethovenkonzert auf derselben Aufnahme ist aber kaum erwähnenswert.
* "Orchester des Jahres - Neue Musik" für Jansons, das BR-Orchester und Bruckner - da kann man sich nur über die Kategorie wundern. Neue Musik im üblichen Sinne wird ja von der Phonoakademie brav ignoriert. Verkauft sich ja auch nicht und steht dem Kulturauftrag, Garrett & Kennedy unter die Massen zu hebeln, gehörig im Wege.
* Für wirklich hohe Kultur darf sich
Cecilia Bartoli den 9. Echo in die Vitrine stellen. Eine schöne sportive Aufnahme für Liebhaber.
* In der Vokalmusik wird mal wieder eine MDG-Aufnahme geehrt, Poulenc-Werke mit dem
Norddeutschen Figuralchor. Dies ist eine Aufnahme, die völlig an mir vorbeiging. Wird bald gehört.
* Da wird eine große Leistung anerkannt: Wolfgang Katschners unermüdliches Bemühen, Alte Musik in spannenden Programmen schmackhaft und lebendig zu machen: völlig verdient dieser Echo für die
Glass-Merula-Platte, die man als Anerkennung für die Gesamtarbeit des Ensembles verstehen darf.
* Nachwuchskünstler, kurz notiert: Christiane Karg werde ich mir noch anhören, Scheps und Ott schwimmen wohl auf der Chopin-Welle (
Edna Stern vermisse ich schmerzlich), Yannick Nézet-Séguin erhält einen Echo für eine recht gediegene Ravel-Platte und das Streichquartett
Meta 4 muss ich wohl schmählich überhört haben. Nachholbefehl!
* Der doppelte Echo für Marek Janowski (
Henzes 9. Sinfonie und die
Steinbacher-Aufnahme) freut mich besonders, da ich ihn für einen der besten Dirigenten unserer Zeit halte. Steinbacher überdies ist eine fulminante Geigerin. Tolle Wahl also.
Jetzt muss ich mich kürzer fassen:
* Sorry, ich liebe meinen Berlioz (Purist, ich) immer noch mit Davis. Da kommt Immerseel nicht ran, auch wenn die
Aufnahme mit viel Herzblut und Wissenschaft gemacht worden ist.
* Mozart mit Zacharias ist eine ziemliche Geschmacksache (aber - bingo - wieder MDG), da überhaupt jemanden aus der Schar der "Großen" zu fischen, halte ich für eine Gratwanderung. Wo sind eigentlich Schuch, Thibaudet, Helmchen !? Immerhin, Kissin mit
Prokofjew 2 & 3 ist auch geehrt.
* DA, doch noch ein Dresdner Preis: Mönkemeyer und die Kapellsolisten erhalten einen Echo für
Weichet nur, betrübte Schatten. Das Original ist besser. Mit Bearbeitungen, Recomposed und Klavierkonzerten fürs Cello wird man uns wohl die nächsten Jahrzehnte jagen, bis alle Partituren durch den (Sony-)Wolf gedreht worden sind. Dann doch lieber Duport im
Original, aber huch, schon wieder MDG - bißchen inflationär, diese Schulterklopferei...?!
* 2010 war offenbar kein Jahr der fantastischen Opernaufnahmen, weder der Festspiele noch der Häuser, vielleicht deshalb "nur" Gluck, Goldmark und Hartmann. Doch, für letzteren großen Dank. Denn Hartmann gehört auch ins sinfonische Repertoire zurückerobert. Und ein zweiter Echo geht ebenfalls an eine
Hartmann-Einspielung, die sich den Streichquartetten widmet.
* Zückerchen gefällig?
Vivica Genaux bekommt ebenso einen Echo wie der "böse"
Bryn. Schöne Platten!
* Was Golijov (wieder einmal) beim Echo zu suchen hat, wird Geheimnis der Universal-Pusher bleiben. Die CDs liegen wie Blei im Laden und jeder verzieht ob des katarrhartigen Eklektizismus das Gesicht beim Hören. Der unverständlichste Echo.
* Der Knabenchor und der Mädchenchor Hannover bekommt einen Echo für die "Glaubenslieder". Die Platte ist bei
Rondeau erschienen und versammelt neue Kirchenkantaten. Ist das die Lanze für die Neue Musik light von der Kirchenempore? Dann bitte doch nicht. Aber vielleicht ist ja auch ein Schmankerl dabei.
* Wer amarcord liebt, findet sie natürlich auch bei diesem Echo wieder: mit der
Rastlosen Liebe wird dann auch endlich die fällig Schumann-Platte geehrt. Wetten dürfen schon abgeschlossen werden, wieviele Mahler-Aufnahmen sich beim Echo 2011 finden werden... - Achja, Harnoncourt bekommt auch einen Echo für die
Jahreszeiten von Haydn. Ganz versteckt werden damit auch Werner Güra und Christian Gerhaher geehrt, zwei herausragende Sängerpersönlichkeiten.
* in der Kammermusik findet sich das Casal Quartett, das Wiener Klaviertrio, das Ma'alot Quintett (mit Rossini), das Belcea Quartett und Isabelle Faust mit ihrer fantastischen
Beethoven-Aufnahme. Hier ist auch ein bißchen 21. Jahrhundert versteckt: das Minguet-Quartett erhält einen Echo für die Einspielung der Streichquartette von
Peter Ruzicka.
* Weitere Echos gehen an Murray Perahia, Hardy Rittner (Schönberg!), Mihaela Ursuleasa, Angelika Kirchschlager, Leif Ove Andsnes, posthum an Sir Charles Mackerras für seine letzte
Martinu-Einspielung.
* Schließlich noch DVD: Die Valencia-Inszenierung des Rings unter Mehta wird geehrt, ebenso Grimauds "Russian Night".
* Naja, und der Bestseller ist eben der Bestseller. Wird aber nicht weiter verlinkt.
Alle Preise zum Nachlesen auf der
Echo-Klassik-Seite. Die Verleihung im Oktober moderiert übrigens Klassikexperte...Thomas Gottschalk. Na denn.
kleines p.s.: interessant vielleicht diesmal, wer den Echo trotz großem Blätterrauschen im Voraus nicht bekommen hat, dazu gehören Anne-Sophie Mutter und Anna Netrebko. Wär ja auch langweilig, oder?